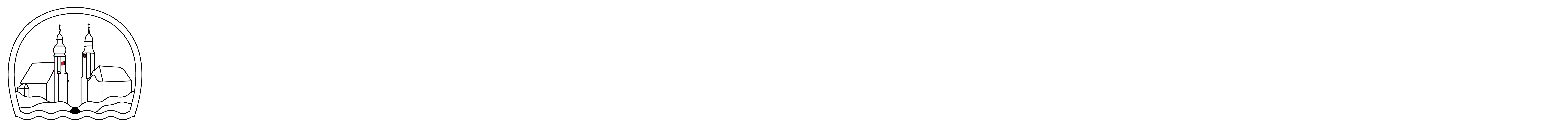Die Entstehung des Dorfes Kühnhaide fällt in die Zeit der Reformation, Rückerswalde, zu dem das „Dörfel ufn Wald“ eingepfarrt war, hatte seit 1529 den reformierten Glauben angenommen. Von hier erfolgte auch die seelsorgerische Betreuung, bis am 24. August 1607 Kühnhaide selbständige Kirchgemeinde wurde. Gottesdienst wurde alle vier 'Wochen von einem Geistlichen aus Rückerswalde im Gasthof (Schenke) für Alte und Gebrechliche abgehalten. Mit der Gründung der Parochie, zu der Reitzenhain und bis 1853 das Filial Rübenau mit den Ortsteilen Ober- und Niedernatschung und dem Ort Einsiedel-Sensenhammer gehörte, erfolgte die Auspfarrung aus Rückerswalde und Kühnhaide bekam 1607 seinen ersten Pfarrer, namens Theophilo Schumann. Gutsherr Caspar von Berbisdorf forcierte das religiöse Leben im Ort. Er beschloss, eine Kirche, ein Schulhaus und ein Pfarrhaus zu erbauen, sowie eine Filialkirche in Rübenau zu errichten. 1608 wird ein Stück Land zum Anlegen eines Gottesackers freigegeben. Eine Vergrößerung des Friedhofes erfolgte 1873 durch Ankauf von 500 Quadratmeter Wiesenland. 1613 bestätigte Kurfürst Johann Georg I. dem Rittergut Kühnhaide das Patronatsrecht der Parochie. In dieser Zeit wird auch der Plan des Caspar von Berbisdorf verwirklicht und Kühnhaide erhält in den Jahren 1613/14 eine Kirche. In diesem neuerbauten Kirchlein kamen viele Menschen aus den Nachbarorten Böhmens, um ihrem Glauben nachgehen zu können, da man dort nicht duldete, dass die Sakramente in der neuen Weise verabreicht werden. In den Kirchen war der Gottesdienst für Protestanten verboten und ihre Geistlichen wurden aus der Stadt vertrieben. Chronist W. Melzer geht davon aus, dass es ein Kirchlein in Holzbauweise gewesen sein soll, denn schon 1688 heißt es in einem Bericht des Gutbesitzers Kaspar Sigismund von Berbisdorf: Die Kirche „muss unumbgänglich bis auf den Grund abgebrochen und wiederumb von neuem aufgebaut“ werden.
Anfang des Jahres 1690 wird mit dem Bau des neuen Gotteshauses begonnen und schon ein Jahr später zum Abschluss gebracht. Die feierliche Einweihung erfolgte am 6. September 1691 mit der Einweihungspredigt des Superintendenten Mag. Chr. Lehmann aus Annaberg. Es war der Höhepunkt des Pfarrers Georg Heinrich Königsdörfer in seinem über 30-jährigen Wirken in Kühnhaide. Er kam aus Freiberg, übernahm 1663 die hiesige Pfarrstelle und verstarb hier im Alter von 60 Jahren am 13. April 1696. Sein Bildnis, wie später auch das des Pfarrers M. Ch. Dietrich, wurde in Anerkennung seines verdienstvollen Wirkens im Ort, in der Kirche aufgehängt. Unter dem Altar befindet sich eine Gruft, in der nach geltendem Patronatsrecht, die Geistlichen und Kammerherren beigesetzt werden durften. 1727 findet hier eine Enkelin des Gutbesitzers von Berbisdorf und 1759 eine Enkelin der Gräfin Solms Teklenburg die ewige Ruhe. Die Kirche ist mit Schindeln gedeckt und von einer Mauer umgeben. Der Altar in heutiger Form besteht zu dieser Zeit nicht. Die Kanzel befand sich an der Südseite, getrennt vom Altar. Eine vorhandene Orgel wird 1722 erwähnt. 1723/24 wird bei einer Kirchenrenovierung die alte Kanzel weggerissen und durch eine neue ersetzt. 1742/43 werden die Blasebälge der Orgel durch ein heruntergefallenes Saigergewicht der Uhr beschädigt. Schulmeister David Härtel behebt den Schaden und erhält dafür 12 Groschen.
Über die Reparatur des Kirchturms an der Westseite finden wir in einer ersten Nachricht aus dem Kirchenknopf im Jahre 1791 folgenden Text: “... Nach beinahe 100 Jahren vom ersten -- an gerechnet war der Thurm derselben allhier so schadhaft und baufällig geworden, dass man sich genöthigt sah, denselben wiederherzustellen. Zu dem Ende ist derselbe im Jahre der Geburt Jesu 1790 unter der Regierung des Herrn Friedrich August Herzog zu Sachsen … auf Anordnung des hochgeborenen Herrn Christoph Heinrich Friedrich Grafen zu Solms Teklenburg Erbl. Gutsherr zu Kühnhaida-Niederschmiedeberg … mit der Wiederherstellung des Kirchthurms zu Kühnhaida der Anfang gemacht und eben in demselben Jahre … wiederaufgesetzt worden …“ (gezeichnet den 24. August 1790, Karl Gottlob Timmel, Pfarrer zu Kühnhaide und Rübenau). In dieser Zeit lebten als Gerichtspersonen in der Gemeinde Johann Gottfried Richter (Ortsrichter), Johann Christoph Richter, Gotthelf Weigel und Andreas Hinkel (Gemeindevorsteher). Auch das Pfarrhaus (Kirchgasse 1) war inzwischen so baufällig geworden, dass Pfarrer M. Ch. G. Dietrich ausziehen musste, um nicht von den „einfallenden Mauern erschlagen zu werden“. 1770 begann man den Abriss. Die Nebengebäude Stall, Wasserhaus, Schuppen und noch verwertbares Bretter- und Balkenmaterial wurden verkauft. 1772 wird mit dem Neubau begonnen. Infolge Geldmangels konnte er jedoch erst drei Jahre später fertiggestellt werden. Die Einwohner der Parochie sahen sich durch den hohen Tribut und die Drangsale des Siebenjährigen Krieges zwischen Preußen und Österreich nicht in der Lage, die finanziellen Mittel dafür aufzubringen. Die einzige Möglichkeit zur Finanzierung der Bauvorhaben bestand in Spenden und dem Erlös einer Lotterie. In einem Gesuch an den damaligen Regenten Prinz Xaver vom 4. Juni 1768 bat der Kirchenpatron Friedrich Graf zu Solms Teklenburg mit Erfolg um die Genehmigung der Kirchenlotterie. Drei Jahre vergingen, ehe sie 1771 mit einem Kapital von 95312 Thaler 12 Groschen sowie 45.000 Losen als „Kühnhaidner Lotterie“ geführt werden konnte. Den Vertrieb der Lose übertrug die Direktion Pfarrer M. Ch. Gottlieb Dietrich und dem derzeit im Ort tätigen Schulmeister John. Carl Gottlob Schimpf, Sekretär des ehemaligen „Floßkommissars“, stellt im Jahre 1772 für die Kirchenlotterie eine Kaution von 1800 Taler und überschreibt sie testamentarisch der Kirche Kühnhaide. Der Wiederaufbau des Pfarrhauses wird nach dreijähriger Bauzeit 1775 fertiggestellt.
Die Kirchturmreparatur verzögert sich. In einem Schreiben an den Superintendenten in Annaberg im Jahre 1783 beklagt Ortspfarrer Dietrich - gesundheitlich schwer gezeichnet - den einsturzgefährdeten Kirchturm und die damit verbundenen Gefahren. Die Instandsetzung und den Wiederaufbau erlebte er selbst nicht mehr. 1790 entstand an der Westseite der heutige Turm, der sich mit seiner Kuppel und Laterne harmonisch in das Landschaftsbild des Ortes einfügt. Pfarrer M. Christian Gottlieb Dietrich verstarb am 23. Mai 1784 nach 42 Jahren Pfarrdienst in Kühnhaide im Alter von 69 Jahren. Schon einen Monat später übernimmt Carl Gottlieb Timmel aus Deutschneudorf, nach dem Ablegen der Probepredigt, in Anwesenheit des Kammerherren Graf zu Solms und Teklenburg, die Pfarrstelle der Parochie Kühnhaide. In einem Schreiben des Grafen zu Solms Teklenburg heißt es: ”… dem Ehrbaren und Wohlgelahrten Carl Gottlieb Timmel: Pfarrer Timmel wird auf Grund seiner Probepredigt eingesetzt. Wohlbekannter Fleiß, Christlicher Lebenswandel, der auf seine Person reflectieret zeichnen ihn aus …“ Pfarrer Timmel ging 1808 nach Crottendorf. Ihm wird der „Ruhm eines wackeren Geistlichen“ von Kühnhaide nachgesagt. In den folgenden zwanzig Jahren kam es zu weiteren baulichen Veränderungen im Innen- und Außenbereich. 1797/98 wird an der Nordseite die neue Sakristei („Vorhäuschen“) angebaut. 1804/05 wurden zwei Fenster vergrößert, um mehr Licht im Presbyterium zu haben. An die Stelle der morschen Dielenbretter werden Steinplatten gesetzt sowie Frauen- und Beichtstuhl neu gebaut. An der Nordseite erfolgen Sanierungsarbeiten. Unklar ist, ob in dieser Zeit der neue Kanzelaltar von der Patronatsherrschaft gestiftet wurde oder erst 1838 beim Einbau der Empore, links vom Altar, entstanden ist. Am 4. Juli 1810 schlug der Blitz in den Kirchturm ein. In einer weiteren Nachricht aus dem Kirchenknopf heißt es dazu: „Im Jahre Christi 1810 den 4. Julius Abends 9 Uhr bei einem fürchterlichen Donnerwetter schlug der Blitz in den Turm, warf die Spindel nebst Knopf gegen 50 Schritte gegen des Wagners Rießens Wohngebäude und warf einen Teil der Gesparre, Spindelbaum … herab … Der Blitz beschädigte ferner Orgel, Sparren, die herrschaftliche Empore, Sacristei, Altar und Taufstein“. Bei der Reparatur im darauffolgenden Monat wird festgestellt, dass auch die Uhr und die kleine Glocke beschädigt sind. 1837 bekommt die Kirche einen neuen Taufstein. Pfarrer Carl Hermann Schulz holt diesen mit seinem eigenen Pferdegespann aus Wolkenstein. Mit dem Einbau der neuen Empore, links vom Altar (Südseite) im Jahre 1838, muss wohl die Kanzel abgebaut und der heutige Kanzelaltar errichtet worden sein.
Die bürgerlich-demokratische Revolution, die 1848 das Land heimsuchte, brachte einige Veränderungen. Die Patrimonialgerichtsbarkeit wird abgeschafft und die Geschworenen vom Volke gewählt. In den Kirchgemeinden werden seit 1868 Kirchenvorstände von „unbescholtenen“ Bürgern gebildet. Der erste Kirchenvorstand bestand, neben dem Pfarrer, aus sieben Mitgliedern, dem Rittergutspächter, dem Fleischermeister August Mayer, dem Gemeindevorstand K. H. Richter, dem Schmiedemeister Rieß, dem Ortsrichter Richter, dem Schlossermeister Franke, dem Gastwirt Nestler und für Reitzenhain Oberförster Täger. (Pfarrer August Wilhelm Rau schreibt in der Schrift des Kirchenknopfes von 1868 Oberförster Träger statt Täger) Sie veranlassten die Ausführung der Reparaturarbeiten an Kirche und Turm. Auf Anordnung des „Königlichen Ministeriums“ werden beide mit Schiefer gedeckt und ein neues Geläut in Aussicht gestellt.
Im Protokoll des Kirchenvorstandes vom 6. Dezember 1869 wird berichtet, dass die Übernahme der Glocken am 17. und 18. Dezember erfolgen kann und Glockengießer Johann Gotthelf Große, Königl. Sächs. Glockengießer in Dresden, das „Aufzeihen“ in der Zeit vom 21. bis 23. Dezember besorgen wird. Für den Tag der Glockenweihe heißt es weiter „die Vorstände der hiesigen drei Vereine, Gemeinderat, Kirchenvorstand, Kinder und Gemeindemitglieder nehmen daran teil“. Die drei Glocken wurden in Dresden gegossen, bestanden aus Bronze und hatten bei 83 cm,67 cm und 55 cm Durchmesser ein Gewicht von 375 kg, 175 kg und 100 kg. Ihre Intonation war dis, f und as. „Zur Ehre Gottes und zur Erbauung der christlichen Gemeinde wurden diese drei Glocken im Jahre 1869 von der Kirchgemeinde Kühnhaide und Reitzenhain beschafft“. Es muss wohl ein erregender und freudiger Tag des Jahres 1869 für die Kirchgemeinde gewesen sein, als erstmals dieses Geläut zu besinnlicher Andacht vom Kirchturm erklang. Glockenklang hat seit jeher Ereignisse bei den Menschen unauslöschlich eingeprägt. Glocken, die zum Gebet riefen, Freude verkündeten, aber auch an Wehmut und Schmerz erinnerten. Keine 50 Jahre vergingen, ehe sie im 400-jährigen Reformationsjahr1917 letztmalig zum Kirchgang erklangen. Sie wurden am 26. Juni „Zur Sicherung des Kupferbedarfs der Heeresverwaltung“ abgenommen und zerschlagen an die Sammelstelle Marienberg abgeliefert.
Bei den 1869 erwähnten und 1872/73 ausgeführten Dacharbeiten an Kirche und Turm wurden das Kreuz und der Knopf abgenommen, neu vergoldet und wieder aufgesetzt, sowie das Zifferblatt der Uhr erneuert, 1895 veranlasste ein durch Blitzschlag entstandener Schaden die Schaffung einer Blitzschutzanlage. Im Jahre 1903 gründete Frau Emma Wilhelmine Wiltzsch eine nach ihr benannte Stiftung. Zur Errichtung einer Kirche in Reitzenhain hat sie in ihrem Testament einen Fond von 3000,– Mark gebildet. 1905 erhielt die Kirche in Kühnhaide aus diesen Mitteln einen vergoldeten Kronleuchter. Das neu gebaute Pfarrhaus (Mitteldorfstraße 10) wird 1912 seiner Bestimmung übergeben.
Eine vorgesehene und bereits begonnene Innenrenovierung unterbricht 1914 der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Bei der elektrischen Erschließung des Ortes im Jahre 1920 erhält die Kirche eine elektrische Beleuchtungsanlage und im gleichen Jahr ein neues Geläut, bestehend aus drei Stahlgussglocken. Die Glocken sind abgestimmt auf C, E und G. Ihre Durchmesser betragen 95 cm, 77 cm und 65 cm. Die Kosten von 1940,94 Mark sind zum Teil durch Listensammlung der Gemeinden Kühnhaide und Reitzenhain aufgebracht worden. Eine 1927 erfolgte Innenausmalung befriedigte nicht. In einem späteren Gutachten bemängelt man ihre aufdringliche Farbigkeit, weil diese sich nicht „in die landschaftliche Herbheit des Erzgebirges“ einfügt.
Die politischen Verhältnisse in den Jahren 1933 bis 1945 und der Zeit danach blieben nicht ohne Auswirkungen auf das Christentum, wie das auch die Kirchgemeinde Kühnhaide erfahren musste.